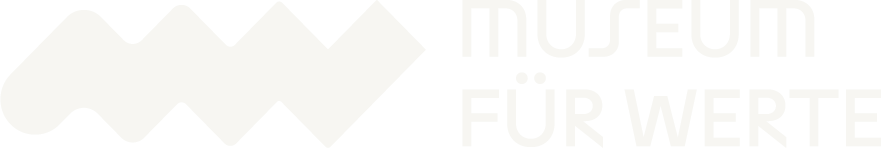Ein Jahr ist es jetzt her, dass ich meinen Vater auf seinem letzten Weg begleiten durfte. Bereits im September zuvor hatten die Ärzte bei ihm zwei Gehirntumore entdeckt und machten uns verständlich, dass eine komplette Heilung nicht möglich sei. Innerhalb von drei Tagen gab ich mein Zimmer im Studentenwohnheim auf, pausierte mein Studium in Österreich und kehrte nach Deutschland zurück. Für mich war es klar, dass ich die kommende Zeit bei meinen Eltern sein wollte und für mich begannen eindrucksvolle Monate. Mein Vater wurde zwar operiert und bestrahlt, aber die Tumore wuchsen von neuem. Eines Abends drückte er meinen Kopf an seine Brust und sagte: „Sei nicht traurig. Es gibt so viele Menschen denen es schlechter geht als mir.“ Mich prägte dieser Moment unglaublich,
denn zu dem Zeitpunkt war er bereits erblindet, halbseitig gelähmt und erkrankte zusätzlich an Epilepsie. Ich wurde Zeuge von der Liebe meiner Eltern - aber nicht nur ich, sondern auch die Krankenschwestern und das Palliativteam. Mein Vater streichelte die Hand und Wange meiner Mutter, wann immer es ging. Er sagte ihr immer wieder, wie sehr er sie liebt und wie hübsch sie ist. Als ich meinen Vater fragte an welchem Ort es für ihn am schönsten war, entgegnete er mir nur mit einem Lächeln: “Daheim bei der Familie.” Mein Vater hatte über 50 Länder bereist und unglaubliche Abenteuer in Asien erlebt, dennoch war er am liebsten zu Hause. Als er im Beisein von meiner Mutter und mir ein letztes Mal im Schlafzimmer ausatmete, musste ich an seine besondere Beziehung zu einem Kloster denken. Nicht nur für die Mönche dieses Klosters - auch für meinen Vater - war der Tod nicht zu einem Feind geworden. Der Tod wurde als Bruder angesehen, den er nicht bekämpfte, sondern respektvoll umarmte und annahm.