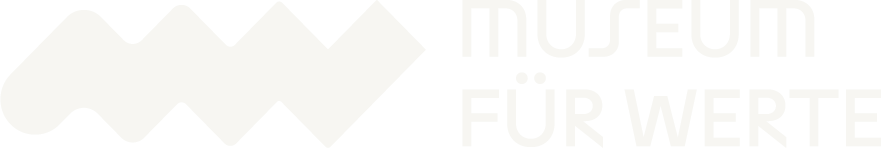Am 16. August 1989 waren die Koffer gepackt, Abschiede wortlos gedacht und letzte Blicke streiften durch die vertrauten Straßen der Pestalozzistraße in Halle an der Saale. Das Westgeld, das sie über die Jahre gesammelt hatten, war versteckt im Absatz des Stöckelschuhs meiner Mutter, im Plastikkörper der Puppe meiner Schwester und im Objektiv der Analogkamera meines Vaters. (...) Um 11 Uhr vormittags ging es los - kein Gerede, keine Fragen, alles war vorab geplant worden und für letzte Zweifel war es zu spät. Meine Mutter erinnert sich an Sandhügel, ein Waldstück, an Schleichen, dann Rennen, an große Angst um ihre Tochter. Irgendwann kamen sie an eine Straße, dort fuhr ein Auto und dann hörten sie Schüsse. Zurückrennend und sich hastig versteckend suchten sie Schutz. Es war unklar, wo sie waren, was hier vor sich ging und woher die Schüsse kamen. Eine unruhige Ewigkeit lang mussten sie warten, bis der Schlepper verkündete, es sei heute zu gefährlich, sie müssten zurück. Was für eine Enttäuschung muss in diesem Moment durch die Köpfe und Herzen der Flüchtenden gewandert sein. (...) Da sich die Situation entspannt hatte, entschloss der Schlepper, dass die Reise weitergehen sollte. Mit gespannten Nerven machten sie sich also auf den Weg. Von all den Tritten, gelungenen oder misslungenen Fluchtversuchen und Transporten, waren die Wege durch den Wald schon plattgetreten und leicht zu begehen. Meine damals fünfjährige Schwester war ruhig und konzentriert, erinnert sich meine Mutter. Sie wusste wohl, dass hier etwas Wichtiges geschieht, doch was genau - wie hätte man das erklären sollen, wo man es doch selbst kaum verstand. Die Gruppe erreichte nun im Gebüsch einen Stacheldrahtzaun, der an einer Stelle aufgeschnitten war. Sie bogen die Teile auseinander und einer nach dem anderen konnte hindurch klettern. Ohne zu wissen allerdings, wo man überhaupt war, oder ob dieser Zaun wirklich in den Westen führte. Auf der anderen Seite sollten sie auf sich gestellt sein. Sie würden Markierungen an den Bäumen vorfinden, die sie zum Dorf führen sollten. Meine Eltern schoben sich als letztes durch den Zaun und beobachteten, wie der Schlepper von jeder Gruppe, die den Osten verließ, noch ein Foto schoss. Was mit diesen Bildern geschah, wissen wir bis heute nicht. (…) Rückblickend fand meine Mutter sich im Westen als Anhängsel ihres Mannes wieder. Ihre Rolle als Frau hatte sich völlig verändert, sie fast in eine Krise gestürzt und sich fragen lassen, was die „Freiheit“ eigentlich wert ist. Abhängig gemacht zu werden vom Mann, das war schlimm für sie und in den ersten zwei Jahren ging es ihr schlecht. Sie hatte nichts, sie war nichts und manchmal wollte sie zurück. Die Leute im Westen hatten eine Wut auf die Ostdeutschen entwickelt - auf den Solidaritätszuschlag, auf überfüllte Supermärkte in Grenzgebieten und auf Zuzug. Im kleinen Dorf in Süddeutschland gehörten sie nicht dazu, verstanden den Dialekt kaum und meine Mutter fand keinen Job. Doch die Mauer war gefallen und ein „Zurück“ sollte es nicht mehr geben. Und irgendwann begannen sich die schönen Seiten zu zeigen. Die ersten Freunde im Westen, die sie nicht fühlen ließen, als wären sie anders. Die ihnen das vorsichtige Gefühl gaben, irgendwo dazu zu gehören. Dass man im Anderssein sich doch auch finden kann. Dass in einer größeren Stadt die migrantische Identität viel leichter zu ertragen ist und dass die Freiheit trotz all den Tributen, die sie forderte, nach all dem doch das höchste Gut bleiben sollte.