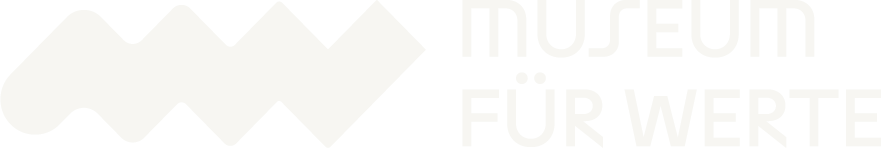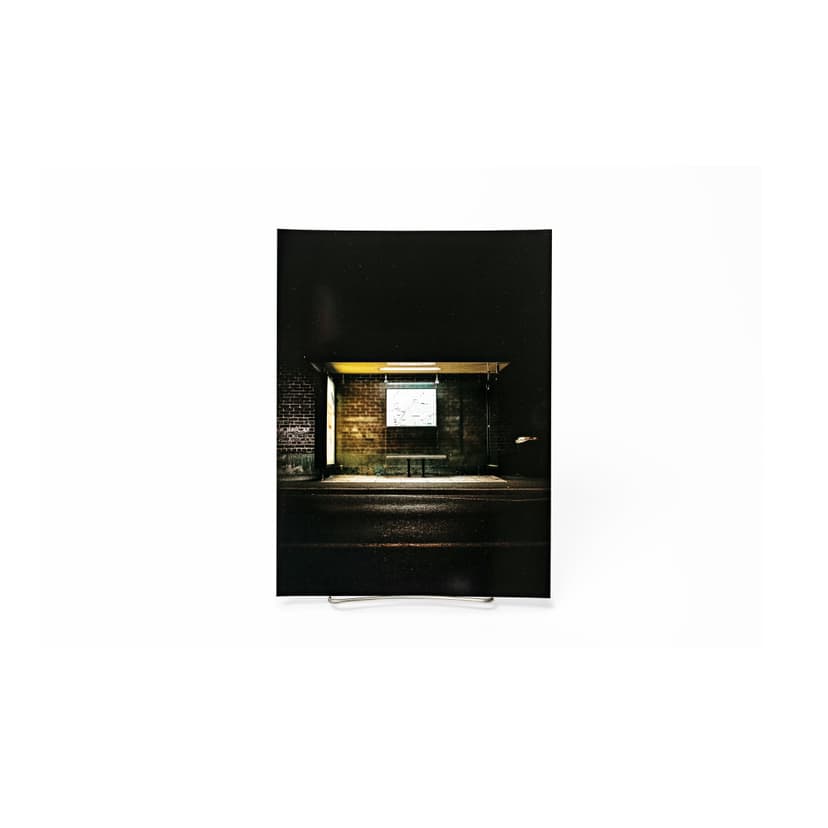2011 habe ich die Mi’kmaqs auf der Insel Neufundland in Kanada besucht. Diese und andere indigene First Nations haben in Kanada viel Diskriminierung, Rassismus und Verfolgung erfahren. Ich wollte erforschen, wie sie heute mit dieser Erfahrung umgehen und zu einem positiven Selbstbild finden. Diese Art der Forschung ist sehr schwer, man bekommt kaum ein Interview, oder wenn doch, ist es mit finanziellen Forderungen verbunden. Hinzu kommt, dass die Erfahrung von Kolonialismus ein sehr sensibles Thema ist. Deshalb war ich sehr dankbar, dass ich die Mi’kmaqs besuchen durfte. Mein erster Eindruck war sehr gut. Ich war vorher in einer anderen Provinz in Kanada gewesen, wo die Indigenen in einem Reservat leben, das von Drogen, häuslicher Gewalt und Alkohol geprägt ist. Mein Besuch in Neufundland war ganz anders. Das Dorf Conne River liegt in einer langen Bucht. Es hat eine Anmutung wie ein norwegischer Fjord. Man fährt durch eine sehr romantische, naturbelassene Strecke, auf der es über 100 km keine andere Siedlung gibt. Im Vorfeld habe ich per E-Mail offiziell um ein Treffen mit dem Stammesrat gebeten und mir eine Erlaubnis eingeholt, forschen zu dürfen. Das wäre anders nicht möglich gewesen, denn der Ort ist nicht touristisch erschlossen, das heißt, es gibt keine offiziellen Unterkünfte. Ich musste dort privat untergebracht werden. Es gab eine Sozialarbeiterin, die mich wie eine Gastmutter aufgenommen hat. Meine Frau war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger und hat mich nicht - wie sonst - bei meinen Forschungsreisen begleitet. Der Stamm war sehr offen, denn sie suchen die mediale Aufmerksamkeit für ihr Anliegen.
Als ich das Dorf das erste Mal betrat, habe ich mich respektvoll verhalten, in dem Bewusstsein, dass ich hier in eine Domäne eintrete, wo ich Bittsteller bin. Und das ist mir in meiner Arbeit ganz wichtig, dass ich nicht von oben herab als weißer dorthin komme. Mein Ziel war es, mit den Menschen zu reden, zu erfahren und teilzuhaben an ihrem Leben. Ich habe sehr früh zu erkennen gegeben, dass ich mich sehr intensiv eingelesen hatte. Ich wusste sehr genau über die Historie des Dorfes Bescheid, mit welchen Problemen die Menschen dort zu kämpfen haben. Diesen Menschen konnte ich gleich zu verstehen geben: Ich weiß um eure politischen Bemühungen um Anerkennung. Deshalb konnte ich sehr gezielte Fragen stellen, die auf Augenhöhe waren. Ich wusste zum Beispiel, dass es einen ganz bestimmten heiligen Ort im Gebirge gibt, der mich interessiert hat und den ich gerne besuchen wollte. Es wurde für mich dann eine Exkursion geplant, diesen Ort zusammen mit dem Häuptling Mi’sel Joe zu besuchen.
Als Ethnologe ist es mir wichtig, dass ich mein Gegenüber nicht dränge oder nötige, sondern mich an die halte, die auch mit mir reden wollen. Ich versuche, offen und transparent meine Ziele zu äußern. Einige Leute gehen darauf ein, andere sagen: Nein, das möchte ich nicht. Und das gilt es dann auch zu respektieren. Ein wirklich guter Ethnologe muss ein Projekt, das er sich vorgenommen hat, vor Ort abbrechen oder zumindest radikal verändern können. Vielleicht waren die Fragen die falschen. Das ist eigentlich für mich als Ethnologen das Schönste, wenn mein Gegenüber sagt: Das ist eine dumme Frage. Oder: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. In diesen Momenten merke ich, dass meine Sichtweise zu stark reinspielt. Und das ist nicht zwangsläufig die Sichtweise der Einheimischen. Und es gab auch Momente, in denen mir Menschen gesagt haben: Das Thema, das du hier ausgesucht hast, ist für uns gar nicht so wichtig. Andere Themen wären viel wichtiger. Dann hat man das Gefühl, dass man wirklich hinter die Fassade schauen darf. Hier kommen wir tiefer ins Gespräch. Überall auf der Welt sind die Leute daran gewöhnt, dass Menschen aus anderen Kulturen zu ihnen kommen, schlicht und ergreifend durch den Tourismus. Jede Kultur hat sich ihre „touristische Fassade“ zugelegt. Und so, wie Menschen aus China vielleicht nach München fahren, um sich das Oktoberfest anzugucken und danach Lederhosen als den Inbegriff des Deutschen ansehen, gibt es natürlich ein ganz anderes Deutschland hinter dem Klischee. Wenn bei den Mi’kmaqs ein Kreuzfahrtschiff vorbeifährt, setzt sich der Häuptling Mi’sel Joe eine Federkrone auf, die für die Prärie-Kulturen typisch ist und unserem Klischee von „Indianern” entspricht. Die Begegnung mit einer anderen Kultur ist eigentlich erst einmal immer die Präsentation des Klischees, die Routine, wie man sich Fremden präsentiert – hinter die Fassade zu blicken, das ist die wahre Herausforderung.
Natürlich gibt es Themen, die mit Scham besetzt sind. An die muss man sich vorsichtig rantasten. Meine Gastmutter zum Beispiel war Christin und ist dann aus der Kirche ausgetreten, weil sie sich scheiden lassen wollte. Das war ein Konflikt mit dem Priester im Dorf, weil die katholische Kirche bekanntermaßen ein Problem mit Scheidungen hat. Wenn man über diese Themen reden möchte, ist es wichtig, auch über sich selbst zu reden: Wer bin ich und wie ist meine Menschlichkeit? Was meine Fehler? Welche Perspektiven habe ich? Wo sind meine Begrenzungen? Ich denke, es ist immer ein Nehmen und Geben. Das heißt aber nicht, dass man sich in diesen Situationen selbst als ein Opfer darstellen sollte. Das wäre falsch. Man sollte eher etwas Intimes teilen, zum Beispiel eine Schwäche.
Ich habe mich mal bei einer Feldforschung in Guatemala lächerlich gemacht. Dort habe ich noch vor meiner Zeit bei den Mi’kmaqs viele Dörfer der Maya besucht. In dem Ort Todos Santos wurde ich eingeladen, bei der Kartoffelernte zu helfen, und da ist es üblich, dass man(n) 100 Kilo Kartoffelsäcke mit einem Stirnband ins Dorf trägt. Das habe ich versucht, leider nicht sonderlich erfolgreich. Darüber hat dann das ganze Dorf sehr herzlich gelacht. Das war ein schöner Moment für die Leute, zu sehen, dass sie Dinge können, die andere Menschen, besonders weiße, nicht können. Wenn man sein eigenes Unvermögen teilt, kann das dabei helfen, sich näherzukommen. Wenn man sich öffnen möchte, kann man auch Geschichten teilen. Ich erzähle oft Legenden oder Geschichten. Grimms Märchen zum Beispiel, oder die Geschichte von Störtebeker. Menschen verschiedener Kulturen teilen häufig ähnliche Geschichten mit einer ähnlichen Moral, das verbindet.
Etwas, über das ich bei meinen Forschungsreisen immer zu Beginn spreche, ist meine Familie. In vielen Kulturen gilt man als Alleinreisender, unverheirateter Mann als Bedrohung. Ich könnte mit einer unverheirateten Frau in vielen Kulturen kein Interview führen. Bei den Maya in Mittelamerika ist ein unverheirateter Mann rechtlich wie ein Kind. Wenn ich keine Ehefrau hätte, dürfte ich dort niemals ein Schamane oder Bürgermeister werden. Mein Ehering ist deshalb ein sehr wichtiges Forschungsutensil.
Am ersten Abend bei den Mi’kmaqs habe ich direkt das Ultraschallbild meines Sohnes herumgezeigt. Als Vater ist man ja stolz. Das sind Momente, in denen sich Menschen öffnen. Ein Mann kam zu mir und meinte, ich solle unbedingt die letzten Monate vor der Geburt nutzen und mit meiner Frau oft ins Kino gehen, aber ja keine Cartoons schauen. Die würde ich in den nächsten Jahren noch oft genug sehen. In diesen Momenten begegnet man sich auf einer persönlichen Ebene. Das schafft eine kulturübergreifende menschliche Verbindung. Und später, als mein Sohn auf der Welt war, sind wir als Familie zusammen gereist. Als kleiner blonder Junge war er in entlegenen Dörfern in Indonesien und Äthiopien eine echte Attraktion. Dann ist man selbst der Exot, der angestarrt wird. Und das ist für mich eine heilsame Erfahrung, weil ich dann im Kleinen begreife, wie es sein muss, wegen seiner Hautfarbe beäugt zu werden. Aber es gibt auch Momente großer Unschuld. In Namibia kam mal ein Kind aus einer armen, nomadischen Hirtenfamilie auf meinen zweijährigen Sohn zu und die beiden teilten Süßigkeiten. Da sieht man, dass Hautfarbe in diesem Alter überhaupt gar keine Rolle spielt.
Als ich bei den Mi’kmaqs war, habe ich Frauen besucht, die in einer Kooperativen gemeinsam Kunsthandwerk betreiben. Da sitzen dann ältere Frauen in einem Zelt zusammen und produzieren Gegenstände und Kleidung aus Leder. Das hat mich natürlich interessiert, einerseits, weil es zum Teil die geringe Arbeitslosenquote in diesem Dorf erklären konnte, aber auch weil es ein sozialer Dreh- und Angelpunkt ist, wo ältere Frauen beisammen sind und sich austauschen, alte Geschichten erzählen, traditionelles Wissen weitergeben. Dieses stundenlange mit Nadel und Faden Zusammensitzen, ist eine Situation, in der viel Raum für Kommunikation ist. Und ein Stück Kunsthandwerk ist gewissermaßen schon ein Zeichen der Offenheit, ein Prozess der Kommunikation, um die eigene Kultur nach außen zu tragen und damit auch zu teilen. Am Ende des Tages schenkten mir die Frauen ein Paar sehr kleine Mokassins für meinen ungeborenen Sohn. Ich denke, man wird ein offenerer und besserer Forscher, wenn man das eigene Menschsein zulässt. Und ich hoffe, dass auch mein Sohn ein Stück weit gelernt hat, nicht nur die Schuhe anderer Kulturen zu tragen, sondern sich auch immer eine Offenheit für andere Kulturen bewahrt. Ihm diese Schuhe als Baby anzuziehen, war vielleicht ein Symbol, ein Versprechen, das ich mir gegeben habe. Und darum haben wir diese Mokassins bis heute aufbewahrt.
Aber Vater zu sein hat auch mich als Forscher sehr bereichert. Durch meinen Sohn habe ich gelernt, dass ich es mir nicht leisten kann, länger so zu tun, als hätte ich keine Meinung. Und teilweise auch, dass ich erst eine Meinung entwickeln muss. Zum Beispiel beim Thema Glauben. Wir haben angefangen, über die Frage von Gott zu reden. Und meine Antwort war dann eine ethnologische: Die einen nennen ihn „Allah“, die anderen „großes Kaninchen“, „Gott“ oder „Jahre“. Manche glauben auch an viele Götter. Aber dann kam zwangsläufig die Frage: Ja, aber was ist jetzt deine Meinung? Deutungsvielfalt befriedigt Kinder nicht. Und viele Gäste in den Lübecker Museen auch nicht.
Fragen zu stellen, ist eigentlich der Schlüssel für Offenheit. Dazu gehört auch die Selbstbefragung. Wir Ethnologen glauben, dass es die Qualität einer ethnologischen Arbeit erfordert, seinem Leser zunächst erst einmal deutlich macht: Von welchem Standpunkt aus schreibe ich dieses Buch? Was habe ich mitgebracht? Was ist mein Interesse? Die Reflexion der eigenen Rolle ist die höchste Tugend in unserer Wissenschaft. Deswegen neigen wir dazu, uns als Individuen stark zurückzunehmen. Mein Sohn erinnert mich daran, dass das nicht hundertprozentig funktionieren kann.
FUßNOTE : Anmerkung der Redaktion: Angehörige:r indigener Völker Nordamerikas