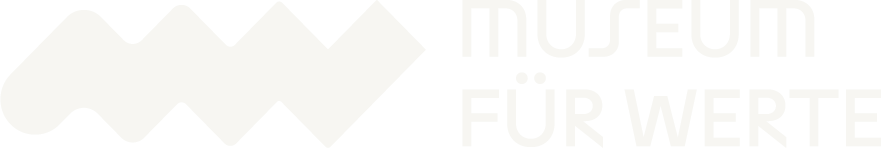Jeder kann sich daran erinnern, wie man Glückwunschkarten mit den bunten Abziehbildchen verzierte. Das hatte einigen Aufwand nach sich gezogen, musste man doch immer etwas Wasser im Gepäck haben oder erst in die Küche rennen. Vor 50 Jahren war das Stressverhalten der Menschen sicherlich anders als heute, doch dachte man schon damals effektiv und v.a. im Fünfjahresplan, der immer höher geschraubt wurde. Nun stellt sich die Frage, wer sich noch an die legendären Rubbelfolien mit den Druckbuchstaben erinnern kann? Nur ein bisschen Nageldruck und fertig war die hübsch verzierte Gratulation für den Brigadevorsitzenden – zwar meist nur in Schwarz/Weiß zu bekommen, doch mit viel kreativem Potential beim gleichmäßigen abrubbeln der Motiv. Der Überraschungseffekt zeigt, ob die Figur auch schön akkurat sitzt. Jetzt gibt es Aufkleber, die jedoch in den 60er Jahren wesentlich teurer waren als die Herstellung mit der Abreibtechnik.Es war ein beschwerlicher Weg, wenn auch nicht aussichtslos, da Eberhard Friedrich eine gute Verbindung nach Berlin hatte. Dort versprach man in einem Empfehlungsschreiben keine Steine bei der Einrichtung der Produktion in den Weg zu legen. Ein Berliner Schreiben zum Karl-Marx-Städter Gewerbeamt sorgte dafür. Vielleicht waren es auch nur Neider, wegen der Ausnahmeangelegenheit eine Firma zu gründen, deren Geschäftsidee wohl kaum reich machen würde. Ende der 1960er organisierte sich Eberhard Friedrich eine riesige ausziehbare Holzkamera im Kastenformat, um Foto-Negative der Schrifttypenentwürfe im Folio-Format zu erstellen. Er experimentierte mit selbstgemischten Wachs- und Seifenemulsionen. Seine Frau druckte und lagerte die fertigen Folien. Immerhin benötigte die Lufttrocknung eine volle Kalenderwoche. Die Materialien waren oft nur unterm Ladentisch oder im Tausch gegen eine Aktzeichnung zu bekommen. Da machte sich die Hobbyarbeit im Zeichenzirkel bei Heinz Tetzner bezahlt - der wiederum war Schüler bei Karl Schmidt-Rottluff. Als sich der erste Verkaufserfolg eingestellt hatte, wurde die Produktion in der privaten Kammer immer beschwerlicher. Nach dem Umzug in eine kleine Lagerhalle an der Neefestraße fertigte man bspw. für Aufsteller an Werkzeugmaschinen der Erfurter Industrie-Messe. Volkseigene Unternehmen aus der ganzen DDR erteilten daraufhin Aufträge. Viele VEBs kamen nicht mehr ohne die praktisch zu handhabenden und variablen Typenfolien aus, welche nicht nur Kosten sondern auch Arbeitszeit einsparten. Es blieb nicht aus, dass auch das Verteidigungs-Ministerium auf die kleine Firma Typoplex aufmerksam wurde. So wollte man die teuren Devisen bei Druckfolien für die NVA einsparen, da die Herstellung im Inland weniger als die Hälfte kostete. Rationalisierung und Planergiebigkeit wurden gefordert. Nach fast fünf Jahren Produktion im kleinen Stil, musste man das im RGW anerkannte Patent Anfang der 1970er an die Regierung verkaufen. Fortan wurde in Thüringen unter der Marke „Typofix“ in einem volkseigenen Betrieb hergestellt und das Ehepaar Friedrich widmete sich alsdann wieder eigenen Arbeiten und Auftragsarbeiten fürs Produktionsdesign der Chemnitzer Werbeschmiede DEWAG, z.B. für Numerik, Fettchemie, Germania.